Auch langjährige Raucher senken ihr Krebsrisiko, wenn sie mit dem Rauchen aufhören. Die Sucht zu überwinden ist nicht einfach, doch die Aussicht auf gewonnene Lebensjahre kann motivieren. Im besten Fall senken auch späte Tabakabstinenzler ihr erhöhtes Krebsrisiko komplett.
Die meisten Menschen fangen bereits im Jugendalter mit dem Rauchen an. Rauchen gehört zum freien Lebensgefühl, die Gedanken kreisen um das Hier und Jetzt, unmerklich wandelt sich das gelegentliche „Mal-Ziehen“ in eine Sucht. Plötzliche ist der Raucher oder die Raucherin 30 Jahre alt und kann auf eine mehr als zehnjährige Tabakkariere zurückblicken. Der naheliegende Gedanke: Nun lohnt sich das Aufhören auch nicht mehr – ist falsch!!!
Das erhöhte Krebsrisiko lässt sich senken
Wie der Deutsche Krebsinformationsdienst schreibt, können ehemalige Raucher, die mit 30 Jahren mit dem Rauchen aufhören, ihr erhöhtes Krebsrisiko wieder auf ein normales Risiko senken. Dieser Umkehreffekt kann jedoch einige Jahre dauern. Selbst wer erst mit 40 Jahre das Rauchen einstellt, senkt sein erhöhtes Risiko an Krebs zu erkranken.
Tabakkonsum verursacht nicht nur Lungenkrebs
Da Tabak inhaliert wird, verbinden viele dessen Konsum mit der Entstehung von Lungenkrebs. Tatsächlich ist diese nur eine von vielen Krebsarten, die in Verbindung mit dem blauen Dunst steht. Ebenso verursacht Rauchen Speiseröhrenkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs, Krebs der Gallenblase und Gallenwege, Leberkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakarzinom, Blasen- und Harnleiterkrebs oder Nierenkrebs. Dazu ist der Tabakkonsum für fast alle Kopf-Hals-Tumoren verantwortlich. Hierzu zählen Krebs der Mundhöhle, des Mund- und Nasenrachenraums, der Nasenhöhle, der Nasennebenhöhle sowie des Kehlkopfes.
Früh erkannter Krebs rettet Leben
Auch wer früh mit dem Rauchen aufhört oder nie einen Glimmstängel anrührte, sollte regelmäßig zur Krebsvorsorge gehen. Denn grundsätzlich gilt: Je früher Krebs erkannt wird, desto besser ist er behandelbar. In Deutschland gibt es unterschiedliche organisierte Programme zur Krebsfrüherkennung. Diese sind Geschlecht und Alter angepasst und werden von den Krankenkassen übernommen. Allerdings decken die Programme nicht alle Krebsarten ab.
Spät erkannte Tumoren
Insbesondere Tumoren im Kopf-Hals-Bereich werden oft spät erkannt. Die Symptome sind diffus und die Diagnose ist häufig sehr aufwendig. Zudem gibt es noch kein einheitliches und durch die Krankenkassen bezahltes Programm zu Früherkennung von Kopf-Hals-Tumoren. Deswegen forschen wir derzeit an einem Krebstest, der nur anhand einer Speichelprobe erkennt, ob ein Tumor im Kopf-Hals-Bereich vorliegt.
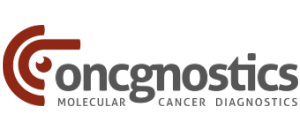
 momo2u/Shutterstock.com
momo2u/Shutterstock.com Image Point Fr/Shutterstock.com
Image Point Fr/Shutterstock.com