Erfahrungsberichte von Frauen in der Familienplanung, bei denen in der Krebsvorsorge ein auffälliger Befund gestellt wurde, sind häufig von Unsicherheit und Frust geprägt. Nach einem gemeinsamen Aufruf mit der Anti-Krebs-Aktivistin Myriam von M. erzählten uns viele Frauen ihre Geschichte. Einige erlebten nach einer durchgeführten Konisation Risikoschwangerschaften oder sogar Fehlgeburten. Sie berichteten von Schuldgefühlen und der Angst vor einer erneuten Schwangerschaft, obwohl sie gern ein (weiteres) Kind bekommen würden.
Auffälliger Befund: Auswirkungen auf die Familienplanung
Treten Auffälligkeiten in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge auf, wie beispielsweise ein auffälliger Pap-Befund oder ein positiver HPV-Test, kann dies zu psychologischen Belastungen führen. Dies zeigt eine neue Studie [1], für die 3.753 Frauen befragt wurden.
- Danach ist nahezu jede zweite Frau psychologisch stark von den Risiken einer Konisation belastet.
- Bei knapp einem Drittel der Befragten hat die Überlegung, eine Konisation durchführen zu lassen, starken Einfluss auf die Familienplanung.
Die Unsicherheit der Frauen ist unter anderem auf die Methode des „Kontrollierten Zuwartens“ zurückzuführen. Festgestellte Auffälligkeiten am Gewebe heilen häufig von alleine wieder aus. Daher werden sie oft über einen langen Zeitraum mit wiederholten Tests beobachtet. Bei Frauen, die noch nicht mit der Familienplanung abgeschlossen haben, kann sich so das Gefühl einstellen, dass ihnen wertvolle Zeit verloren geht. Auch das Wissen darum, dass sich Gebärmutterhalskrebs über viele Jahre entwickelt, kann die Frauen mit Kinderwunsch unter Zeitdruck setzen. So kann es sein, dass die Frau so schnell wie möglich schwanger werden möchte, bevor der vermeintlich schlechte Befund des Gebärmutterhalsabstriches noch weiter fortschreitet.
Gibt es einen Zusammenhang von Konisation und Frühgeburt?
Bleiben die Untersuchungsergebnisse auffällig oder verschlechtert sich der Befund, verdichten sich somit die Anzeichen für eine Krebserkrankung. In dem Fall kann vom Arzt eine Konisation empfohlen und durchgeführt werden. Dabei wird der Gebärmutterhals kegelförmig ausgeschnitten [2].
Es ist umstritten, ob es einen direkten Zusammenhang zwischen einem solchen Eingriff und späteren Frühgeburten gibt. Verschiedene wissenschaftliche Studien legen jedoch nahe, dass das Risiko für eine Frühgeburt nach einer durchgeführten Konisation zunimmt.
Beispielsweise zeigen Studienergebnisse von 2010 [3]:
- Jede dritte Frau, bei der zwei solcher Eingriffe durchgeführt wurden, erlebten eine Frühgeburt vor der 37. Schwangerschaftswoche. Von den Frauen mit einer Konisation passierte dies elf Prozent, ohne Konisation vier Prozent.
- Extreme Frühgeburten vor der 28. Schwangerschaftswoche kamen bei drei Prozent der Frauen vor, die zwei Konisationen durchführen ließen. Von den Frauen mit einer Konisation war es ein Prozent, von denen ohne einen Eingriff 0,3 Prozent.
Entsprechend nachvollziehbar ist es, dass betroffene Frauen beunruhigt sind, wenn sie eine erste oder weitere Schwangerschaft planen.
Anzeichen von Gebärmutterhalskrebs: Schwangerschaft nicht unmöglich
An dieser Stelle ist es wichtig festzuhalten, dass Auffälligkeiten in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge dem geplanten Familienzuwachs nicht grundsätzlich im Weg stehen. Hier gilt es, die Anzeichen genau zu deuten. Eine Infektion mit Humane Papillomaviren (HPV) kann Krebs auslösen, das muss jedoch nicht geschehen. Ein Großteil der Frauen hat in ihrem Leben eine HPV-Infektion, die meist völlig unbemerkt von allein wieder ausheilt. Ein zusätzlicher auffälliger Pap-Befund kann sich zudem nicht nur verschlechtern, sondern auch verbessern. Nur selten entsteht wirklich Krebs. Gebärmutterhalskrebs entsteht über verschiedene Vorstufen. Er kann bereits in einem frühen Stadium entdeckt werden. In diesem Fall ist die Krebserkrankung fast immer heilbar. Die Gebärmutter selbst bleibt erhalten und nimmt keinen Schaden.
Deutlich wird, dass regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt während der Familienplanung bereits vor einer Schwangerschaft dazugehören. Bei auffälligen Pap-Befunden oder HPV-Infektionen können molekularbiologische Verfahren dabei unterstützen, herauszufinden, ob diese Auffälligkeiten tatsächlich auf eine zu behandelnde Krebsvorstufe oder bestehende Krebserkrankung zurückzuführen sind. Die Zeit der engmaschigen Kontrolle beim Frauenarzt kann somit deutlich verkürzt und klare Vorgehensweisen schnell beschlossen werden. Auch können so im Einzelfall operative Eingriffe wie eine Konisation verhindert werden.
Quellen
[1] Jentschke et al. (2020): Psychological distress in cervical cancer screening: results from a German online survey, in: Archives of Gynecology and Obstetrics 302:699–705.
[2] https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/leben-mit-krebs/kinderwunsch-und-krebs/erhalt-der-fruchtbarkeit.html
[3] Ørtoft et al. (2010): After conisation of the cervix, the perinatal mortality as a result of preterm delivery increases in subsequent pregnancy, in: BJOG 117:258–267.
Titelfoto: Africa Studio/Shutterstock.com
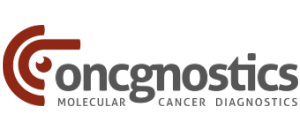
 Africa Studio/Shutterstock.com
Africa Studio/Shutterstock.com Dirk Rohde
Dirk Rohde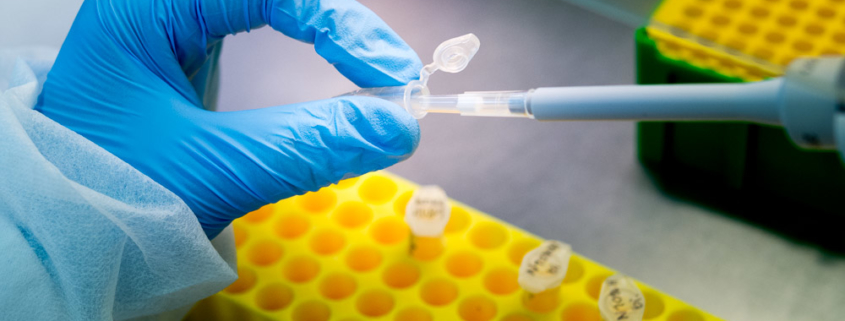 oncgnostics GmbH
oncgnostics GmbH Claudia Braunstein/oncgnostics GmbH
Claudia Braunstein/oncgnostics GmbH