Deutschlandweit erkranken jährlich etwa 7.300 Frauen an Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom), mehr als 5.000 Betroffene sterben jährlich an den Folgen. Das bedeutet, dass eine von 72 Frauen irgendwann im Leben eine Eierstockkrebs Diagnose erhält. Bei den Betroffenen verändern sich Zellen an einem oder beiden Eierstöcken bösartig und beginnen, unkontrolliert zu wachsen. Da um die Eierstöcke herum viel Platz ist, in dem sich der so entstehende Krebs ausbreiten kann, bemerken viele Frauen die Krankheit erst spät – mit bösen Folgen.
Wer ist betroffen?
Das Risiko für einen Tumor am Eierstock steigt mit zunehmendem Alter. Ab dem 50. Lebensjahr nimmt die Erkrankungsrate kontinuierlich zu. Eierstockkrebs tritt dann gehäuft auf. Im Durchschnitt sind die Betroffenen 69 Jahre alt, wenn sie die Diagnose erhalten. Neben dem höheren Alter gehört auch Übergewicht zu den Eierstockkrebs-Risikofaktoren.
Zudem kann die Krankheit erblich bedingt sein und in einer Familie gehäuft auftreten (sog. familiärer Eierstockkrebs). Besondere Aufmerksamkeit ist daher geboten, wenn Fälle von Eierstock- oder Brustkrebs in der direkten Verwandtschaft bekannt sind.
Zu weiteren Ursachen für Eierstockkrebs können Hormonersatztherapien während der Wechseljahre zählen. Frauen, die sich entsprechend behandeln lassen, erkranken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an Eierstockkrebs. Die Gefahr sinkt jedoch wieder, wenn die Einnahme der Hormone mindestens zehn Jahre zurückliegt.
Frauen, die Kinder geboren haben, erkranken seltener an Eierstockkrebs. Das gilt auch für diejenigen, die im gebärfähigen Alter die Anti-Baby-Pille genommen oder mindestens ein Kind gestillt haben.
Symptome: Eierstockkrebs wird häufig spät bemerkt
Durch ihre Lage im Bauchraum haben Eierstock-Tumoren viel Platz, um unbemerkt zu wachsen. Die Betroffenen haben deshalb in der Regel lange keine Beschwerden.
Verdachtsmomente können diese sein:
- Blutungen außerhalb der Monatsregel oder nach den Wechseljahren
- Ein größerer Bauchumfang ohne an Gewicht zuzunehmen
- Völlegefühl, Blähungen oder Bauchschmerzen sowie ungewohnte Verdauungsbeschwerden, die mit einem verschlechterten Allgemeinzustand einhergehen
- Häufigeres Wasserlassen als normal
Wenn Ihnen diese Symptome bekannt vorkommen und sie über längere Zeit anhalten, sollten Sie dies von einer Ärztin oder einem Arzt abklären lassen.
Verdacht auf Eierstockkrebs: Untersuchung und Therapie
Wenn ein Verdacht auf einen Tumor an den Eierstöcken besteht, werden diese in einer gynäkologischen Untersuchung abgetastet. Zusätzlich wird oft eine Ultraschalluntersuchung über die Scheide als IGeL-Leistung angeboten. Die Trefferquote hierbei ist kritisch zu betrachten, da Tumoren im Ultraschall nicht von anderen Zysten unterschieden werden können. Wird dennoch ein Tumor im Eierstock entdeckt, entscheidet dessen Stadium über die weitere Behandlung.
Nach der FIGO-Klassifikation (International Federation of Gynecology and Obstetrics) wird Eierstockkrebs in vier Stadien eingeteilt:
- I: Der Tumor befällt einen oder beide Eierstöcke.
- II: Der Krebs breitet sich im Beckenraum aus.
- III: Außerhalb des Beckens finden sich Krebszellen in der Bauchhöhle oder den Lymphknoten.
- IV: Tumorzellen haben sich in andere Körperregionen außerhalb der Bauchhöhle angesiedelt.
Durch die unklaren Symptome für Eierstockkrebs wird die Krankheit oft erst im Stadium III oder IV erkannt. Wenn möglich, entfernen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte das Eierstockkarzinom in einer Operation komplett. Daran schließt fast immer eine Chemotherapie an.
Eierstockkrebs: Heilungschancen in frühem Stadium gut
Wird Eierstockkrebs in einem frühen Stadium erkannt, sind die Heilungschancen relativ gut. Die relativen Überlebensraten nach fünf Jahren liegen bei 89 Prozent im Stadium I bzw. bei 77 Prozent im Stadium II. Je weiter der Tumor fortgeschritten ist, desto schlechter stehen die Chancen auf Heilung. Kommt es trotz Operation und Chemotherapie zu einem Rückfall (Rezidiv), kann die Erkrankung nicht mehr geheilt, sondern nur noch palliativ behandelt werden.
Entsprechend wichtig ist eine gute Nachsorge. An die eigentliche Behandlung schließt eine engmaschige Kontrolle mit regelmäßigen Untersuchungen an. Auch eine psychoonkologische Betreuung oder Rehamaßnahmen können sinnvoll sein.
Forschungsprojekt zur Früherkennung
Derzeit gibt es keine spezielle Vorsorgeuntersuchung zur Früherkennung von Eierstockkrebs. In einer Kooperation mit der Frauenklinik des Universitätsklinikums in Jena forschen wir daran, geeignete Tumormarker bei Eierstockkrebs für eine verbesserte Diagnostik zu finden. Mit diesen soll die Krankheit früher erkannt und die Heilungschancen erhöht werden.
Fragen Sie den Arzt oder die Ärztin Ihres Vertrauens
Quellen
Deutsches Krebsforschungszentrum (2020): Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom). www.krebsinformationsdienst.de
Deutsche Krebsgesellschaft (2018): Eierstockkrebs: Basis-Infos für Patienten und Angehörige. www.krebsgesellschaft.de
Zentrum für Krebsregisterdaten (2017): Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom). www.krebsdaten.de
Universitätsklinikum Tübingen: Eierstockkrebs – der stille Feind. www.medizin.uni-tuebingen.de/expertentipps
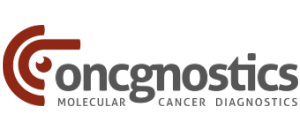
 Shutterstock
Shutterstock Shutterstock
Shutterstock